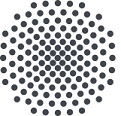Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-45
| Autor(en): | Jooß, Rüdiger |
| Titel: | Schutzverantwortung von Gemeinden für Zielarten in Baden-Württemberg |
| Sonstige Titel: | conservation responsibilities of the municipalities of Baden-Wuerttemberg for target species |
| Erscheinungsdatum: | 2006 |
| Dokumentart: | Dissertation |
| URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-29679 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/62 http://dx.doi.org/10.18419/opus-45 |
| Zusammenfassung: | Ziel der Arbeit ist es, eine Einschätzung der Aussagekraft der im Rahmen des Projekts "Informationssystem Zielartenkonzept Baden-Württemberg (ZAK)" entwickelten Methodik der Zuweisung ‚besonderer Schutzverantwortungen’ für Zielarten der Fauna zu den Gemeinden Baden-Württembergs zu erhalten.
Mit dem "Informationssystem ZAK" wurde ein webbasiertes Planungswerkzeug zur Erstellung faunistischer Zielarten- und Maßnahmenkonzepte entwickelt, das auf dem Zielartenkonzept Baden-Württemberg aufbaut. Ziel der Informationsebene "besondere Schutzverantwortung" des Planungswerkzeugs ist es, der Naturschutzverwaltung und Entscheidungsträgern zu verdeutlichen, für welche Lebensraumtypen einer Gemeinde eine besondere Verantwortung aus landesweiter Sicht für Schutz und Entwicklung charakteristischer Zielarten zukommt. Hintergrund ist, dass noch großräumig bzw. zahlreich vorhandene Biotoptypen innerhalb der Gemeinden oft als wenig schutzbedürftig eingeschätzt werden. Zudem stellen Grenzen administrativer Einheiten aus ökologischer Sicht betrachtet meist willkürliche Ausschnitte der Landschaft dar. Gleichzeitig werden hier raumwirksame Entscheidungen getroffen, deren ökologische Wirkungen weit über den administrativen Zuständigkeitsbereich hinaus reichen können. Der entwickelte Ansatz basiert auf dem "Verantwortlichkeitskonzept" im Naturschutz.
Anhand GIS-gestützter Landschaftsanalysen wurden landesweit Flächen mit besonderer potenzieller Habitateignung ("Habitatpotenzialflächen") für 25 zu ökologischen Anspruchstypen gruppierte Zielartenkollektive der Fauna räumlich abgebildet. Dies geschah in Form wissensbasierter Habitatmodelle durch die Umsetzung von Schlüssel-Habitatfaktoren der Anspruchstypen in landesweite GIS-Datensätze und die Anwendung expertenbasierter Selektionsregeln. Aus den Flächenkulissen der Habitatpotenzialflächen wurden über zwei Indikatoren, welche die Flächengröße und die Verbundsituation der Potenzialflächen berücksichtigen (Indikatoren "Flächengröße" und "Biotopverbund"), über ein Rankingverfahren für jeden Anspruchstyp Vorranggebiete aus landesweiter Sicht ausgewählt. Den Gemeinden mit Anteil an den Vorranggebieten wurde eine besondere Schutzverantwortung für den jeweiligen Anspruchstyp bzw. das zugehörige Zielartenkollektiv zugewiesen.
Im Rahmen der Dissertation wurden verschiedene Aspekte der Gesamtmethodik für ausgewählte Anspruchstypen anhand tierökologischer Geländedaten validiert. Analysiert wurden der Anspruchstyp "Kalkmagerrasen" in Bezug auf die Artengruppen Tagfalter, Widderchen und Heuschrecken, der Anspruchstyp "Streuobstgebiete" hinsichtlich der Avifauna, der Anspruchstyp "Lössböschungen und Hohlwege" bzgl. ausgewählter Wildbienen-Arten sowie der Anspruchstyp "Ackergebiete mit Standort- und Klimagunst aus tierökologischer Sicht" anhand der Verbreitung der Grauammer. Untersucht wurden die Fragestellungen:
(1) Validität der landesweiten Habitatmodelle
(2) Eignung der Indikatoren "Flächengröße" und "Biotopverbund" zur Auswahl von Vorranggebieten
(3) Lage tierökologisch besonders bedeutsamer Gebiete ("hotspots") in Gemeinden mit besonderer Schutzverantwortung
(4) Empirische Analyse der Zielartenhypothese.
Für die Umsetzung des Indikators "Biotopverbund" wurde mit der Erzeugung der "potenziellen Verbundräume" ein neues GIS-basiertes Verfahren zur Verbundanalyse von Flächenkonfigurationen entwickelt und empirischen Prüfungen anhand tierökologischer Geländedaten unterzogen. Mit der "Radialen Sichtkantenanalyse" wurde ein bestehendes Verfahren der Verbundanalyse weiterentwickelt.
Für die Validierungen kamen neben diversen Verfahren der schließenden Statistik auch explorative Methoden wie Ähnlickeitsanalysen und multivariate Ordinationsverfahren sowie die Analyse geschachtelter Artengemeinschaften ("nestedness") zum Einsatz.
Für die analysierten Anspruchstypen und Artengruppen kann gezeigt werden, dass die entwickelte Methodik zur Zuweisung besonderer Schutzverantwortungen zu den Gemeinden Baden-Württembergs insgesamt konsistent und plausibel ist. Die Flächenkulissen der Habitatmodelle weisen eine hohe Übereinstimmung mit dem Vorkommen charakteristischer Zielarten auf. Die Indikatoren "Flächengröße" und "Biotopverbund" zur Auswahl von Vorranggebieten erweisen sich in der Kombination als geeignet, tierökologisch besonders bedeutsame Gebiete - mit vorrangigem Vorkommen hochrangiger Zielarten - auszuwählen. Die Zuweisung besonderer Schutzverantwortungen - unter vergleichender Anwendung verschiedener Schwellenwerte zur Auswahl von Vorranggebieten - verdeutlicht die Konsistenz der entwickelten Methodik. Die Anwendung strenger Schwellenwerte resultiert in einer systematischen Erfassung zunächst derjenigen Gemeinden mit den höchsten Zielartensummen. Bei Anwendung weiter gefasster Schwellenwerte erfolgt eine sukzessive Ausdehnung der besonderen Schutzverantwortung auf Gemeinden mit einer geringeren Anzahl gemeldeter Zielarten. Die Validierungen zeigen, dass in den Gemeinden mit besonderer Schutzverantwortung ein besonders bedeutsames Habitatangebot aus landesweiter Sicht besteht und ein vorrangiges Vorkommen hochrangiger Zielarten festgestellt werden kann.
Die Informationsebene dient der Identifizierung der "Eigenart" einer Gemeinde aus naturschutzfachlicher Sicht. Sie soll zur Zielbestimmung von Naturschutzstrategien und zur Leitbildentwicklung herangezogen werden. Mit der konsequenten Anwendung des "Informationssystem ZAK" und der Berücksichtigung der besonderen Schutzverantwortungen der Gemeinden kann künftig ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt in Baden-Württemberg geleistet werden. The objective of the doctoral thesis was to validate the approach of assigning "special conservation responsibilities" for fauna target species to the municipalities of Baden-Wuerttemberg. This approach was developed within the framework of the project "Information System Target Species Concept Baden-Wuerttemberg". The information system is a web-based planning tool to design conservation strategies for animal target species within landscape planning on municipality-level. The section on the "special conservation responsibilities" aims to spatially define conservation priorities and to identify the natural characteristics of municipalities. The information is derived from the statewide conservation priorities laid down in the "Target Species Concept Baden-Wuerttemberg". Borders of administrative units like municipalities are in most cases ecologically arbitrary sections of the landscape. At the same time they serve as planning units where decisions are made with impacts that can influence the ecosystem well beyond the administrative borders. Therefore the developed approach provides local authorities and decision makers with the information which of the municipalities' habitat-types and target species have a great importance as seen from the statewide perspective and should therefore be in the focus of conservation strategies. The developed approach is based on the "responsibility concept" in nature conservation. For this purpose an approach has been developed, as a first step aggregating target species into 25 ecological groups with similar habitat profiles (ecological guilds). Then knowledge-based habitat-models for these ecological groups were developed to define areas with high habitat potential over the whole state. Finally, a selection procedure identified priority areas using the criteria "patch-size" and "patch-connectivity". A special conservation responsibility for each ecological group was assigned separately to those municipalities covering the selected priority areas or parts of them. Within the doctoral thesis various aspects of the developed approach were validated for selected ecological groups and their corresponding habitat-types using fauna field data. The habitat type "unimproved calcareous grasslands" was analysed using field data for butterflies, burnet moths and grasshoppers. The habitat type "open orchard meadows" was validated using data on breeding birds. The habitat types "slopes and sunken paths in loess" was analysed using selected character bee-species and "arable land with favourable soils and continental climate" by comparing it with the distribution of the characteristic bird-species Corn Bunting. The following research questions were analysed: (1) validity of the statewide habitat models (2) suitability of the criteria "patch-size" and "patch-connectivity" to select priority areas (3) the spatial correspondence of areas with high fauna biodiversity ("hotspots") and municipalities with "special conservation responsibilities" (4) empirical analyses of the target species hypothesis. To apply the criteria "patch-connectivity" a new method for analysing the connectivity of habitat networks was developed. This GIS-based procedure derives so called "Potential Habitat Networks" ("potenzielle Verbundräume"). In addition, with the "Radial View-Edge Analysis" ("Radiale Sichtkantenanalyse") an existing GIS-based procedure for the connectivity-analysis of habitat networks was enhanced. The validation was carried out on different fauna data sets using statistical techniques such as explorative methods including similarity analyses, multivariate ordination and the analyses of nested species assemblages. For the analysed habitat-types and target species it can be proved that the developed approach of assigning "special conservation responsibilities" for target species to municipalities is consistent and leads to plausible results. The potential habitats derived from habitat modelling show a high correspondence with the occurrences of characteristic target species. The criteria "patch size" and "patch connectivity", combined, are suitable for selecting priority areas with prominent occurrences of high-ranking target species. The assignment of "special conservation responsibilities" using a range of threshold values for the selection of priority areas via the criteria "patch-size" and "patch-connectivity" show the consistency of the developed approach. Comparison of different versions initially show a systematic coverage of municipalities with the highest numbers of reported target species when the smallest threshold value is applied. The application of broader threshold values leads to a gradual extension of the "special conservation responsibilities" into municipalities with fewer target species. This supports the assumption that the developed approach produces a consistent assessment of municipalities with high fauna biodiversity. In total the validation shows that municipalities with a "special conservation responsibility" comprise an especially significant setting of potential habitats seen from a statewide perspective. Predominant occurrences of high ranking target species can be observed there. The information serves the identification of the typical natural characteristics of the municipalities. They should be consulted when defining priorities for species protection and for the development of strategies for nature conservation. Its integration within the "Information System Target Species Concept" enables a standardised consideration in planning processes. Therefore the "special conservation responsibilities" can serve as an important contribution to the conservation of biodiversity in Baden-Wuerttemberg. |
| Enthalten in den Sammlungen: | 01 Fakultät Architektur und Stadtplanung |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dokument_01.pdf | 11,99 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| Dokument_02.pdf | 5,14 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.