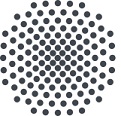Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-14381
| Autor(en): | Spilker, Alexandra |
| Titel: | Zur experimentellen Bestimmung der Wärmedehnzahl von Beton im Straßenbau |
| Erscheinungsdatum: | 2024 |
| Dokumentart: | Dissertation |
| Seiten: | xv, 156 |
| URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-144003 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/14400 http://dx.doi.org/10.18419/opus-14381 |
| Zusammenfassung: | Rechnerische Analysen im Zuge der Dimensionierung und Substanzbewertung gewinnen im Betonstraßenbau zunehmend an Bedeutung. Eine hinreichende Kenntnis über das im nationalen Betonstraßenbau spezifische thermische Ausdehnungsverhalten des Baustoffs Beton ist für eine adäquate Berücksichtigung bei der Modellbildung essenziell. Den aktuellen Ansätzen liegen ingenieurtechnische Annahmen zugrunde, die auf allgemeinen Richtwerten aus den 1960er Jahren basieren. Eine systematische und gezielte Verknüpfung mit aktuelleren Erkenntnissen sowie auf den nationalen Betonstraßenbau ausgerichtete labortechnische Untersuchungen fehlen. Derzeit existieren national und europäisch jedoch keine standardisierten oder genormten Verfahren zur experimentellen Bestimmung der Wärmedehnzahl von Beton. Diese Arbeit verfolgt zusammenfassend folgende konkrete Zielstellungen: a) Erstellung einer geschlossenen Abhandlung zur Thematik der Wärmedehnzahl von Betonen mit spezifischer Ausrichtung auf den nationalen Straßenbau und die Verwendung des Kennwertes für rechnerische Analysen b) Schaffung von Grundlagen für die Aufnahme eines Prüfverfahrens zur Bestimmung der Wärmedehnzahl in die TP B-StB c) Überprüfung vorhandener Literaturwerte hinsichtlich der spezifischen Verwendbarkeit im Betonstraßenbau d) Bewertung des aktuellen Dimensionierungsansatzes in den RDO Beton In Kontext der Verwendung von Wärmedehnzahlen für rechnerische Analysen im Betonstraßenbau ergibt sich eine sehr hohe Bedeutung in Bezug auf zwei Komplexe, die für die Dauerhaftigkeit von Fahrbahndecken aus Beton entscheidend sind. Zum einen beeinflusst die Wärmedehnzahl maßgeblich das Längs- und Querdehnungsverhalten der Decke. Zum anderen stellt sie einen maßgebenden Parameter für die rechnerische Dimensionierung dar. Darüber hinaus hängt der maßgebende Anteil der mechanischen Beanspruchung von Fugenfüllsystemen bei Decken in Plattenbauweise insbesondere auch von der Wärmedehnzahl des Betons ab. Zur Bewertung der Genauigkeit experimentell bestimmter Wärmedehnzahlen wurden Sensitivitätsanalysen mit den rechnerischen Verfahren zur Dimensionierung und Substanzbewertung durchgeführt. Im Ergebnis sollte bei der Bestimmung von Wärmedehnzahlen zur Nutzung als Eingangsdaten in die Berechnungen eine relativ hohe Genauigkeit von ± 0,3 ∙ 10-6/K angestrebt werden. Es wurden zwei Prüfansätze zur experimentellen Bestimmung der Wärmedehnzahl entwickelt, angewendet und kritisch analysiert. Zur Messung der thermisch bedingten Längenänderung werden ein Setzungsdehnungsmesser mit digitaler Messuhr (Prüfansatz 1) sowie induktive Wegaufnehmer (Prüfansatz 2) verwendet. Es zeigt sich, dass insbesondere unter Verwendung von induktiven Wegaufnehmern eine sehr gute Reproduzierbarkeit der Messergebnisse erzielt werden kann. Um die Richtigkeit der Prüfergebnisse beurteilen zu können, wurden Bezugswerte an Referenzmaterialien anhand von Dilatometermessungen an verschiedenen Instituten ermittelt. Für den hier betrachteten Temperaturbereich zwischen 0 °C und 40 °C ergeben sich mittlere Wärmedehnzahlen für eine Edelstahl- bzw. Aluminium-Legierung in Höhe von 15,40 · 10-6/K bzw. 21,69 · 10-6/K. In Vergleichsuntersuchungen wurde eine sehr gute Annäherung der Prüfergebnisse bei Verwendung von Prüfansatz 1 (PA1) sowie von Prüfansatz 2 (PA2) mit einer Aluminium-Legierung als Kalibriermaterial an die Bezugswerte erzielt. Die Abweichungen liegen zwischen 0,07 bis 0,21 · 10-6/K. Eine erste allgemeine Einschätzung zur Genauigkeit der Prüfergebnisse zeigt, dass bei Verwendung von PA2 die geforderte Genauigkeit des Prüfergebnisses von ± 0,3 · 10-6/K bei einem Konfidenzniveau von 95 % auch bei sehr kleinen Stichproben erfüllt wird. Bei PA1 kann bei größeren Stichproben dieser Genauigkeitsanforderung entsprochen werden. Vor dem Hintergrund einer höheren Praktikabilität wird der PA1 für die umfassenden Bestandsuntersuchungen herangezogen. Den Bestandsuntersuchungen lag eine Stichprobe von 58 Bestandsstrecken aus dem BAB-Netz zugrunde. Die Probekörper wurden auf den maßgebenden lufttrockenen Zustand konditioniert. Es ergaben sich Wärmedehnzahlen der Straßenbetone für die einzelnen untersuchten Schichten zwischen 7,4 - 12,2 ∙ 10-6/K, wobei - wie zu erwarten - die niedrigen Dehnungswerte bei kalkreichen Gesteinskörnungen und die höheren Werte bei Kiesen mit einem hohen Anteil an Quarzgestein festgestellt wurden. Der aktuell für den Regelfall in der rechnerischen Dimensionierung vorgesehene Richtwert für die Wärmedehnzahl von 11,5 ∙ 10-6/K wird in 7,5 % der untersuchten Betone überschritten. Die verfügbaren Literaturwerte können in Form der angegeben Mittelwerte nur als Orientierung herangezogen werden. Für die im Straßenbau zum Einsatz kommenden Kiese, welche hinsichtlich der Gesteinsart heterogen zusammengesetzt sind, liegen keine Literaturwerte vor. Orientierungsmessungen zum Einfluss der Betonfeuchte auf die Wärmedehnzahl zeigen, dass bei wassergesättigten Proben im Vergleich zu lufttrockenen die Wärmedehnzahl durchschnittlich um 2,7 ∙ 10-6/K geringer ausfällt. Bei der Bestimmung der Wärmedehnzahl an wassergesättigten Probekörpern sollte das Prüfergebnis nach aktuellem Wissensstand um 25 % erhöht werden. Aufbauend auf dieser Arbeit sollte zur Überführung eines Prüfverfahrens in die TP B-StB zunächst eine Arbeitsanleitung für einen Prüfansatz oder mehrere Prüfansätze erarbeitet und anschließend ein Ringversuch zur Bestimmung der Präzisionskenndaten durchgeführt werden. Zur Qualitätssicherung wird es als zwingend erforderlich angesehen, durch eine zentrale Stelle Referenzprismen aus Metall mit zugehörigem Bezugswert für die Wärmedehnzahl zur Verfügung zu stellen. Perspektivisch sollten die Bestandsuntersuchungen systematisch fortgesetzt werden, um zum einen ein verbessertes Verständnis zur zeitlichen Entwicklung der Wärmdehnzahlen von Straßenbetonen in situ zu erlangen und zum anderen die Datenbasis insbesondere von Betonen mit hohem thermischen Dehnungsvermögen zu erhöhen. Darüber hinaus sollten vor dem Hintergrund des hohen Einflusses aus dem Feuchtegehalt des Betons die realen Feuchteverteilungen über die Deckenhöhe sowie innerhalb einer Fahrbahnplatte (Plattenmitte, Plattenrand) eruiert werden, um Rückschlüsse auf die feuchtebedingten Streuungen der Wärmedehnzahl im Bauteil ziehen zu können. |
| Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation_SPILKER.pdf | 12,65 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.